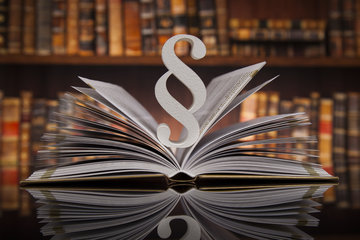Das LG Frankenthal hat sich in seiner rechtskräftigen Entscheidung vom 25.01.2024 (Az. 7 O 13/23) zu den Grenzen der Beratungspflicht durch Energieeffizienzberater/-innen geäußert.
Demnach haftet ein - in diesem Fall - Architekt, wenn er im Rahmen der Beratung zur Fördermittelbeantragung die (eigentums)rechtlichen Fördervoraussetzungen fehlerhaft eingeschätzt hat und infolge der entsprechenden Beratung der Auftraggeberseite dieser ein finanzieller Schaden entsteht.
Konkret ging es um den Rat, dass es für den Investitionszuschuss der KfW zu einer WEG-Sanierung im Rahmen des Programms 430 genüge, wenn bei Antragstellung eine Vormerkung und bei Auszahlung das geänderte Eigentum vorliegen würde. Dies ist zum einen schon rechtlich nicht korrekt und führte auch zu einer Ablehnung des Antrags. Hätte die Auftraggeberseite den Antrag erst gestellt, nachdem die Umwandlung in Wohnungseigentum abgeschlossen war, hätte sie die Fördermittel erhalten; der entsprechende Schaden beruht also auf dem falschen (Rechts)rat.
Zum anderen stelle, so das LG, die Empfehlung zu einer vermeintlich der Interessenlage der Auftraggeber entsprechenden Veränderung der Eigentumslage an dem zu sanierenden Gebäude zwecks Erfüllung der persönlichen Fördervoraussetzungen im Programm 430 der KfW eine Rechtsdienstleistung dar, die dem Energieberater auch nicht in Ausnahme von § 3 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) nach § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 RDG erlaubt war. Auch die HOAI könne den Kreis der erlaubten Rechtsberatung insoweit nicht erweitern; vielmehr ist sie im Lichte des RDG zu verstehen.
Ein Energieberater habe stets die Pflicht, diejenigen Leistungen zu erbringen, die erforderlich sind, um die mit dem Auftraggeber vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen. Dies umfasse "unzweifelhaft die nach den jeweiligen Förderprogrammen maßgebliche Erreichung bestimmter technischer Werte durch die vorzunehmenden Baumaßnahmen sowie deren Dokumentation, Prüfung und Darlegung gegenüber der fördernden Stelle", außerdem das Aufzeigen geeigneter Programme "bezogen auf den Bauten- und aktuellen Eigentumsstand".
Entsprechend nicht umfasst werde laut LG hingegen die Frage der "Eigentumsumgestaltung am Grundstück, auf welchem die gegebenenfalls zu fördernde Maßnahme ausgeführt wird", denn hierfür sei eine Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall durch konkrete Subsumtion eines Sachverhalts unter die maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen erforderlich, die über die bloße schematische Anwendung von Rechtsnormen ohne weitere rechtliche Prüfung hinausgeht - so die ständige höchstrichterliche Rechtsprechung.
Zwar müssten alle Planer/-innen über "nicht unerhebliche Kenntnisse des Werkvertragsrechts, des BGB und der entsprechenden Vorschriften der VOB/B verfügen" (vgl. auch Urt. v. 26.04.1979, Az. VII ZR 190/78) und im Einzelfall "das planerische, wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Vorhabens" erläutern und dabei "öffentlich-rechtliche Vorschriften zum Bauplanungs- und Bauordnungsrecht" in die Beratung miteinbeziehen (vgl. BGH Urt. v. 11.02.2021, Az. I ZR 227/19). Eine allgemeine Rechtsberatung wird von den Berufsbildern Architekt/-in und Ingenieur/-in nicht erfasst, da es insoweit an einer hinreichenden juristischen Qualifikation fehlt (vgl. BGH Urt. v. 09.11.2023, Ar. VII ZR 190/22). Ob es sich dabei um eine einfache oder schwierige Rechtsfrage handelt, ist unerheblich (BGH, Urt. v. 31.03.2016, Az. I ZR 88/15).
Die Entscheidung des LG im Volltext finden Sie unter folgendem Link: LG Frankenthal 7 O 13/23
Anzumerken ist, dass das LG in der gesamten Entscheidung nicht auf § 5 Abs. 2 Nr. 3 RDG eingeht, wonach Rechtsdienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Fördermittelberatung erbracht werden, als erlaubte Nebenleistungen gelten. Da der Schaden bereits durch die an sich falsche Beratung entstanden ist, ist die Gerichtsentscheidung im Ergebnis richtig, könnte aber für Verunsicherung sorgen.
Im Übrigen wird eine unerlaubte rechtsberatende Tätigkeit regelmäßig nicht von der Berufshaftpflichtversicherung übernommen. Insoweit ist ohnehin Zurückhaltung bei rechtlichen Ratschlägen geboten.
Es besteht dann jedoch die Pflicht, die Auftraggeberseite auf den Umstand hinzuweisen, dass eine rechtsberatende Tätigkeit nicht erlaubt ist, und entsprechend auf Einholung von Rechtsrat bei einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt zu verweisen. Erfolgt dies nicht, handelt es sich um eine Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, die ebenfalls einen Schadenersatzanspruch begründen kann. Auch dieser Hinweis war im vorliegenden Fall unterblieben.